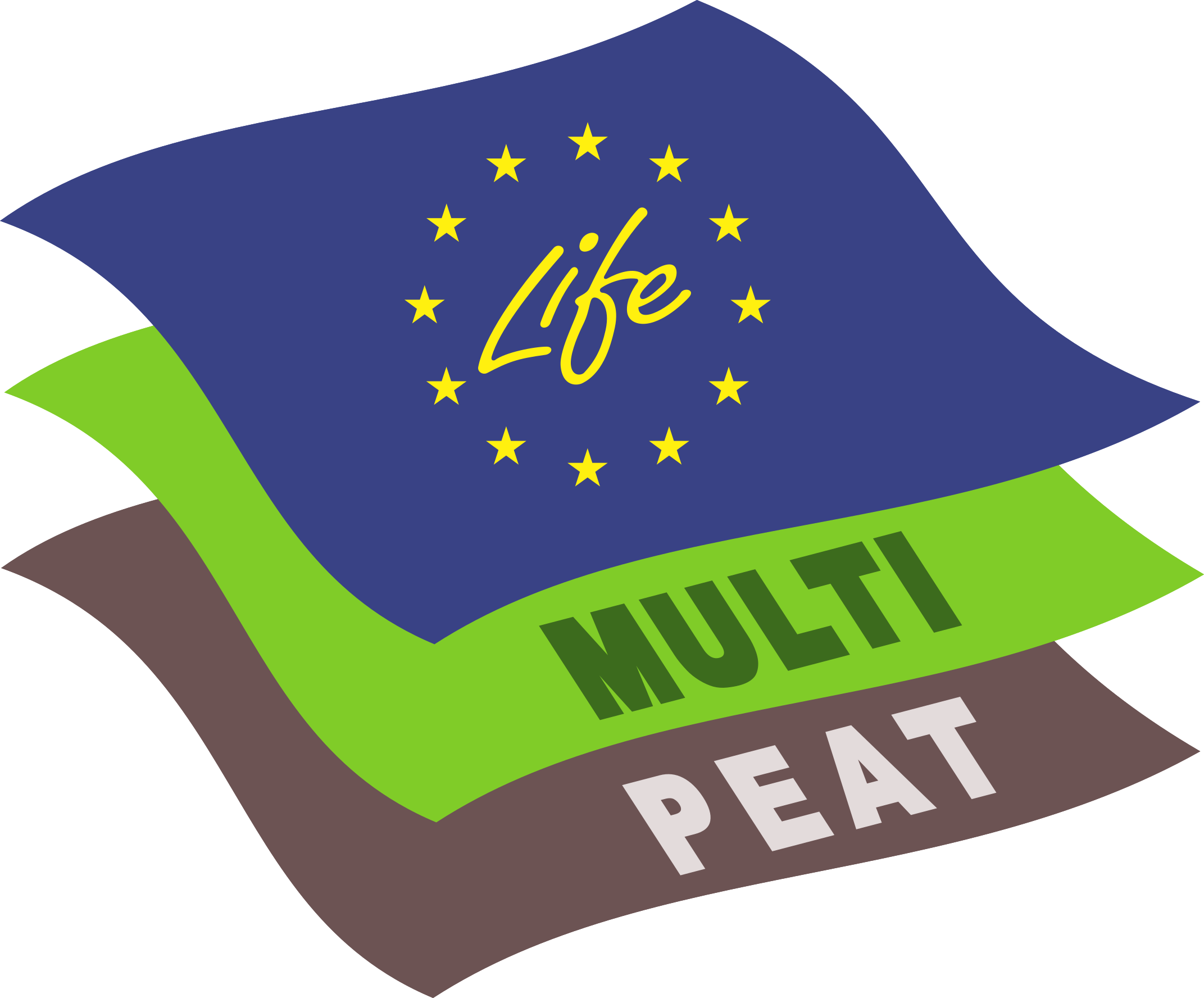LIFE Multi Peat
Kohlenstoffgutschriften aus Moorgebieten - ein Erfahrungsaustausch mit Rewilding Europe
Kohlenstoffgutschriften aus Moorgebieten - ein Erfahrungsaustausch mit Rewilding Europe
Eine erste Diskussion über Verifizierungsstandards und -ansätze für die Verringerung von Treibhausgasemissionen aus Mooren.
Am 6. Juni 2024 veranstalteten die Projekte LIFE Multi Peat und Peat Carbon einen Workshop zu den methodischen Aspekten von Verifizierungsstandards für Kohlenstoffgutschriften. Experten beider Projekte und des niederländischen Programms Valuta Voor Veen erörterten, wie Landbesitzer effektiv Kohlenstoffgutschriften aus Torfgebieten verkaufen können. Da es immer noch viel Unwissenheit, Misstrauen und regelrechte Verwirrung zu diesem Thema gibt, wurde Rewilding Europe eingeladen, das Verfahren vorzustellen und den Teilnehmern zu zeigen, wie sie mit Landbesitzern zusammenarbeiten, um Kohlenstoffgutschriften zu verkaufen.
Als Projektentwickler will die Stiftung Rewilding Europe eine finanziell wettbewerbsfähige Landnutzung ermöglichen, indem sie zeigt, dass sie ein Investitionspotenzial hat und vor allem die Wiederherstellung in großem Maßstab mit Vorteilen für die lokalen Gemeinschaften ermöglicht. Die Stiftung unterstützt bereits die Universität Galway, den Multi Peat-Partner in Irland, bei der Entwicklung von Kohlenstoffgutschriften für ihr Moorgebiet. Diese Initiative könnte zum ersten Verkauf von Kohlenstoffgutschriften aus Torfgebieten in Irland führen.
Standards für die Verifizierung von Kohlenstoffgutschriften
Während der Präsentation von Rewilding Europe erfuhren wir, dass für die Entwicklung von Kohlenstoffgutschriften aus einem Moorgebiet ein Standard für die Verifizierung von Kohlenstoffgutschriften angewendet werden muss. Es gibt regionale, nationale und internationale Standards, die den Rahmen vorgeben, an dem sich der Landbesitzer von Anfang an bis zum Verkauf der erzeugten Kohlenstoffgutschriften orientieren kann; der Prozess umfasst die vorbereitenden Arbeiten und die Planung, die Erstellung einer Baseline, die eigentliche Wiederherstellung sowie die fortlaufende Überwachung des Gebiets nach der Umsetzung. Im Wesentlichen regelt der Standard die Regeln für die Messung, Berichterstattung und Überprüfung der Emissionsgutschriften.
Welcher Standard gewählt wird, kann davon abhängen, ob das Land, in dem sich der Standort befindet, seine eigenen Standards entwickelt hat. Viele Länder sind dabei, nationale oder regionale Standards zu entwickeln; so haben beispielsweise die deutschen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Moorfutures. Die Niederlande und das Vereinigte Königreich haben kürzlich einen Valuta Voor Veen bzw. einen UK Peatland Code entwickelt. Auf internationaler Ebene ist der Verra-Standard einer der am meisten anerkannten. Das Weißbuch des Projekts Interreg Care-Peat bietet einen guten Überblick und eine Analyse der verschiedenen anwendbaren Standards.
Aus der Sicht des Landbesitzers kann die Einhaltung der Standards kompliziert und teuer sein, außerdem ist der finanzielle Ertrag ungewiss, da er von den Kohlenstoffpreisen und den natürlichen Merkmalen des Standorts, z. B. dem Grad der Degradation, abhängt. In der Tat müssen viele Aspekte berücksichtigt werden, damit ein Standort als förderungswürdig eingestuft wird und die THG-Reduktionen verifiziert und als Emissionsgutschriften verkauft werden können. Diese können je nach dem angewandten Standard variieren, betreffen aber im Allgemeinen die Landbesitzstruktur, die erlaubten Aktivitäten innerhalb und in der Umgebung des Standorts, die Kriterien für die Definition von Torfgebieten und mehrere andere wichtige Elemente, die von Rewilding Europe in der Präsentation erörtert wurden, wie etwa die Überwachungsanforderungen zur Festlegung der Ausgangssituation und künftiger Szenarien.
Die Gruppensitzung
Während der Gruppensitzungen, bei denen die Teilnehmer in kleinere Gruppen aufgeteilt wurden, wurden die folgenden Fragen diskutiert:
- Was lässt Sie zögern, wenn Sie versuchen, Kohlenstoffgutschriften aus Moorgebieten zu verkaufen?
- Was fehlt noch oder was sind die praktischen oder institutionellen Grenzen?
- Würden Sie allein vorgehen oder lieber extern vergeben?
Die häufigsten Gründe für das Zögern waren nach Ansicht der Experten das Konzept der Zusätzlichkeit, die Ungewissheit über die Einnahmen, das Fehlen nationaler Rahmenregelungen, die Unsicherheit über die Methoden zur Quantifizierung der Emissionsreduzierung, Fragen bezüglich des Zeitrahmens für die Kohlenstoffgutschriften sowie Bedenken hinsichtlich der Umweltverschmutzung. Ein weiterer Grund für das Zögern ist die Befürchtung, dass es zu Fehlanreizen kommen könnte, wenn Landbesitzer, deren Torfgebiete stärker geschädigt sind, im Rahmen von Kohlenstoffgutschriften belohnt werden, während Landbesitzer, die ihre Torfgebiete in gutem Zustand erhalten haben, nicht profitieren. Auf diese Weise werden Landbesitzer aus Ländern, in denen sich noch ein größerer Anteil der Torfgebiete in gutem Zustand befindet, nicht von Kohlenstoffgutschriften profitieren.
Bei der Beantwortung der zweiten Frage nach praktischen und institutionellen Beschränkungen nannten die Experten technische, rechtliche und finanzielle Hindernisse. Was die Überwachungstechniken anbelangt, so sollte das primäre Überprüfungssystem immer noch die direkte Messung sein, da sie zur Kalibrierung und Korrektur der Modellierung dient. Allerdings ist diese Technik in der Regel sehr teuer und kann für die meisten Landbesitzer ein Hindernis darstellen.
Außerdem wurde häufig die Frage des Vertrauens aufgeworfen. Regionale und nationale Normen wurden im Vergleich zu größeren internationalen Normen als vertrauenswürdiger angesehen. Der allgemeine Ansatz der Einheitsgröße für alle ist nicht ideal. Die Standards sollten besser auf das jeweilige Gebiet zugeschnitten sein, da die Bedingungen in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind, und selbst wenn die Länder ähnliche Landschaften und Merkmale aufweisen, kann die Landnutzung sehr unterschiedlich sein. So stellt beispielsweise eine zersplitterte Grundbesitzstruktur mit mehreren kleineren Grundstücken eine erhebliche Einschränkung dar, da benachbarte Ländereien de facto ein Vetorecht haben.
Schließlich blieb nur noch wenig Zeit für die Diskussion der letzten Frage. Die allgemeine Meinung war, dass die Auslagerung nur die Kosten eines ohnehin schon sehr teuren Unterfangens erhöhen würde, ohne dass eine angemessene Rendite garantiert werden könnte. Allerdings wurde auch eingeräumt, dass die Auslagerung von Dienstleistungen angesichts der Komplexität des Verfahrens und der Systeme für Kohlenstoffgutschriften den Landbesitzern sehr helfen könnte.
Mitnahme
Es gibt immer noch unzählige Fragen, Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit Kohlenstoffgutschriften für Moorgebiete. Dennoch erfordern die dringende Biodiversitäts- und Klimakrise sofortiges Handeln. Es gibt bereits internationale und in einigen Fällen auch regionale und nationale Standards, die angewendet werden können. Eine erweiterte Nutzung dieser Systeme ist erforderlich, um ihre Zuverlässigkeit weiter zu verbessern und die öffentliche Akzeptanz zu erhöhen, mit dem grundlegenden Ziel, eine erhebliche Ausweitung von Wiederherstellungsinitiativen zu ermöglichen. Letztendlich können wir nicht auf das perfekte System und ein umfassendes Wissen über die Dynamik der Treibhausgasflüsse warten. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, und weiterhin versuchen, uns auf dem Weg zu verbessern.
Eine ausführlichere Zusammenfassung des Workshops finden Sie unten unter dem Titel 'Workshop summary report'