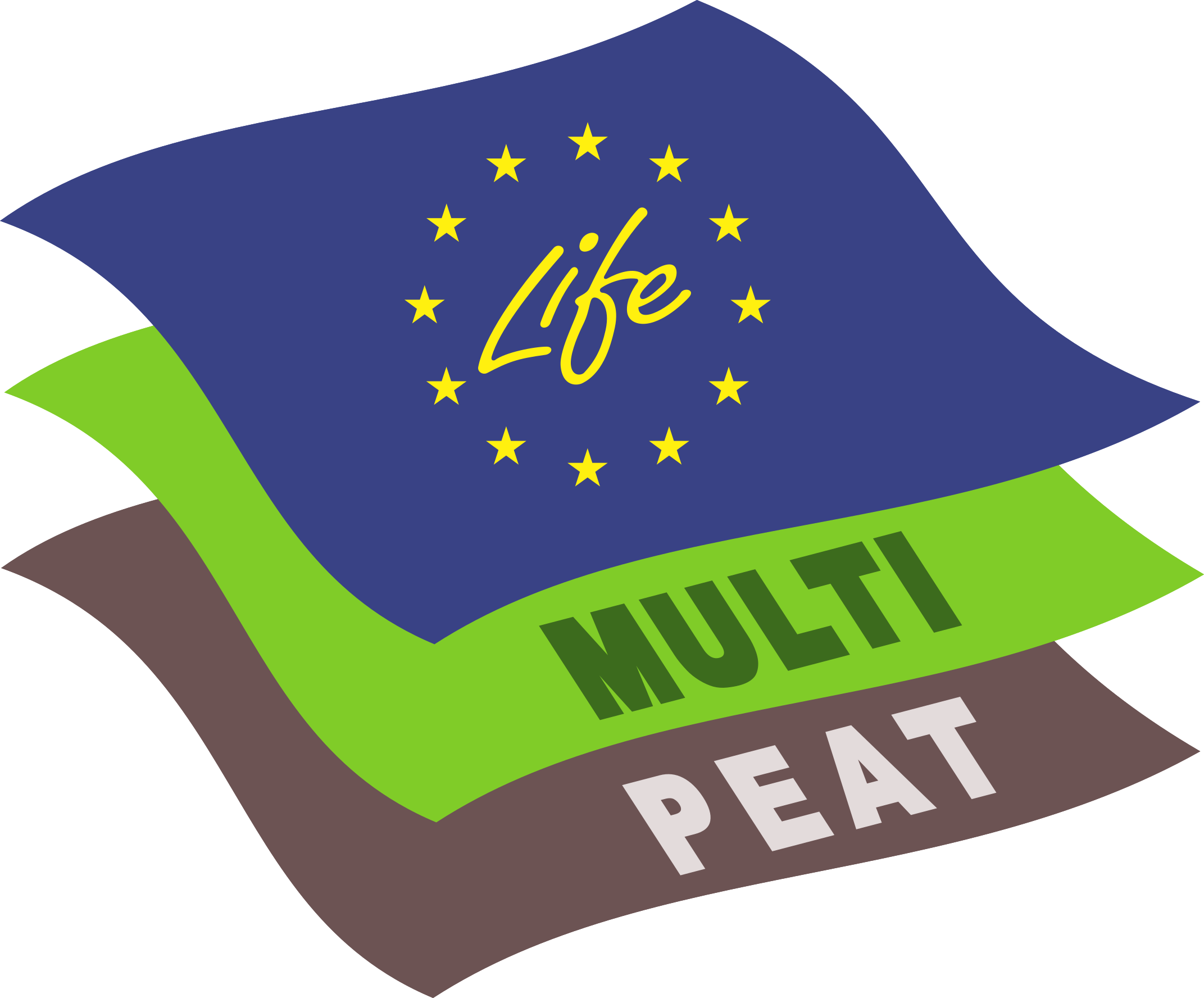LIFE Multi Peat
10. Treffen der Europäischen Arbeitsgruppe für Moorpolitik: Deutschlands Moorschutzbestrebungen
10. Treffen der Europäischen Arbeitsgruppe für Moorpolitik: Deutschlands Moorschutzbestrebungen
Neue Initiativen und Fortschritte im deutschen Moorschutz
Das 10. Treffen der European Peatland Policy Working Group (EPPWG) am 5. Juni 2024 brachte Experten und Akteure verschiedener Institutionen zusammen, um den aktuellen Stand und zukünftige Strategien für den Moorschutz in Deutschland zu diskutieren. Die Veranstaltung mit Vorträgen der Succow-Stiftung, der ZUG gGmbH, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUV) und des NABU beleuchtete die wichtige Rolle der Moore für den Klimaschutz und die Förderung der Biodiversität. Zu den wichtigsten Themen gehörten die laufenden Wiedervernässungsmaßnahmen, die Umsetzung der Nationalen Moorschutzstrategie, der Aktionsplan des Bundes für naturnahe Lösungen und innovative Ansätze für eine nachhaltige Landwirtschaft durch Paludikultur.
Einblicke der Succow-Stiftung in den Moorschutz
Sophie Hirschelmann und Jan Peters von der Succow-Stiftung, einem Partner des Greifswalder Moorzentrums, gaben zu Beginn des Treffens einen umfassenden Überblick über den Zustand der Moore und die Renaturierungsmaßnahmen in Deutschland. Hirschelmann zeigte auf, dass von den 1,8 Millionen Hektar Moorflächen in Deutschland 94% entwässert sind und nur 2% in einem naturnahen Zustand verbleiben. Diese Entwässerung stellt eine große Herausforderung für die Klimaziele dar, da sie diese Moore von einer Kohlenstoffsenke in eine Kohlenstoffquelle verwandelt.
Zurzeit werden jährlich etwa 2.000 Hektar Moore wiedervernässt, aber diese Zahl liegt unter den 50.000 Hektar, die zur Erreichung der Klimaziele erforderlich sind. Hirschelmann erläuterte mehrere Initiativen, darunter die Nationale Moorschutzstrategie (2022-2030) und die Einrichtung einer Mooragentur in Mecklenburg-Vorpommern, die sechs neue Moormanager ernannt hat. Ergänzt werden diese Bemühungen durch neue Agrarumwelt- und Klimaregelungen und die Umsetzung von Maßnahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die darauf abzielen, Landwirte zu moorschonenden Praktiken zu ermutigen.
Peters fuhr fort mit einem Schwerpunkt auf praktischen Anwendungen und Kooperationen. Er hob mehrere vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderte Modell- und Demonstrationsprojekte hervor und betonte die zunehmende Beteiligung der Landwirte. Die Initiative PaludiZentrale (2023-2033) zielt darauf ab, den Anbau, die Nutzung und die Vermarktung von Moorkulturen zu integrieren und ihre Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz, die biologische Vielfalt und die Hydrologie zu bewerten. Peters erwähnte auch die Initiative "Tomoorow", die die Zusammenarbeit zwischen Umweltschutz, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fördert, um Biomasse in Wertschöpfungsketten einzubinden.
Bundesstrategien und Aktionspläne
Tom Kirschey von der ZUG gGmbH gab einen Überblick über den Bundesaktionsplan "Naturnahe Lösungen für Klima und biologische Vielfalt" und erläuterte dessen Ziel, den Zustand und die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen zu verbessern, um die Widerstandsfähigkeit und die biologische Vielfalt zu erhöhen. Der Plan umfasst 10 Handlungsfelder mit 69 Maßnahmen, wobei ein Schwerpunkt auf dem Schutz intakter und der Wiedervernässung degradierter Moore liegt.
Dr. Marco Brendel vom BMUV ging auf die Einzelheiten des Bundesaktionsplans "Naturnahe Lösungen für Klima und biologische Vielfalt" ein. Zentrale Bestandteile sind die Umsetzung der Nationalen Moorschutzstrategie und der Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorschutz. Brendel hob das ehrgeizige Ziel hervor, durch diese Maßnahmen die jährlichen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu reduzieren.
Der Plan befasst sich auch mit der Verbesserung des Zustands ungenutzter und geschützter Moore, der Entwicklung neuer Wertschöpfungsketten für die Paludikultur und dem Ausstieg aus der Gewinnung und Nutzung von Torf. Projekte in landwirtschaftlichen Betrieben und Förderrichtlinien sollen diese Initiativen unterstützen und die Wiedervernässung und Renaturierung auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen fördern.
NABUs regionale Bemühungen und Herausforderungen
Jonathan Etzold vom NABU sprach über das LIFE-Multi-Peat-Projekt und die Bemühungen des NABU im Häsener Luch. Das Kerngebiet des Projektes umfasst 19 Hektar, die geschützt sind und sich im Besitz einer NABU-Regionalgruppe befinden. Der Erwerb weiterer Flächen ist im Gange. Trotz des Fortschritts sind Herausforderungen wie bürokratische Hürden, Grunderwerbs- oder Tauschverfahren und Verhandlungen mit Grundeigentümern nach wie vor groß. Die umliegenden Landeigentümer gaben ihre Zustimmung zu einer versuchsweisen Wiedervernässung. Nach ihrer Zustimmung wurden die Schachtwehre repariert und das erste Jahr der versuchsweisen Wiedervernässung abgeschlossen, wodurch der Wasserspiegel in den Wintermonaten fast auf Grundniveau anstieg.
Einbindung von Interessenvertretern und Ausblick
Abschließend wurde über die Einbindung von Interessenvertretern und die Einstellung der Landwirte zum Moorschutz diskutiert. Die Landwirte erkennen zwar die langfristigen Probleme trockengelegter Torfgebiete an, warten aber auf angemessene Anreize und Entschädigungen, um sich an den Erhaltungsmaßnahmen zu beteiligen.
Insgesamt unterstrich das Treffen die dringende Notwendigkeit, weiterhin in den Schutz und die Wiederherstellung der Moore in Deutschland zu investieren, zusammenzuarbeiten und innovative Lösungen zu finden. Mit der Entwicklung von Strategien und neuen Projekten soll eine nachhaltige Zukunft geschaffen werden, in der Moore eine zentrale Rolle beim Klimaschutz und bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt spielen.